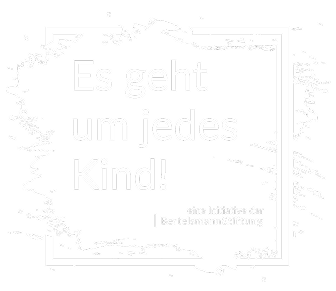Unsere Initiative möchte bereits bestehende Stärken des Kita-Systems wieder hervorheben und professionelles Handeln der pädagogischen Fachkräfte stärken. Dafür machen wir auf Widersprüche im aktuellen Diskurs aufmerksam, erweitern ihn gemeinsam mit Expert:innen um viele bereits bekannte Erkenntnisse, die in Vergessenheit geraten sind, und bieten evidenzbasierte Lösungsansätze.
In unserem Discussion Paper setzen wir uns mit vier zentralen Themen auseinander, um Kitas, Fachkräfte und Kinder zu stärken: Was macht den Auftrag von Kitas so besonders? Wie gestalten pädagogische Fachkräfte die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes? Was macht professionelles Handeln im Kita-Alltag aus? Wie kann eine Qualitätssteuerung aus der Praxis heraus gelingen?
Im gesetzlichen Auftrag der Kindertagesbetreuung sind Bildung, Betreuung und Erziehung als gleichwertige und untrennbare Aufgaben verankert, um die Lebenswelt jedes einzelnen Kindes zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Trias sind KiTas für die Für-Sorge, das Wohlbefinden und den Schutz der Kinder verantwortlich – sie erfüllen deren Grundbedürfnisse und beteiligen sie am KiTa-Alltag, um ihnen Bildungserfahrungen zu ermöglichen. So fördern KiTas jedes Kind ganzheitlich und individuell in seiner Persönlichkeitsentwicklung und ermöglichen ihm in der Kindergemeinschaft das Erleben von demokratischer Teilhabe, Diversität und Gerechtigkeit für ein solidarisches Miteinander.
Damit jedes Kind sein persönliches und unser gesellschaftliches Leben mitgestalten kann, braucht es vielfältige Kompetenzen, die Grundlage für eine Handlungs- und Gemeinschaftsfähigkeit sind. Angesichts unabsehbarer Zukunftsentwicklungen reicht eine Förderung anhand vorab definierter Entwicklungsnormen nicht aus, da die Kinder auf diese Weise nur auf Bestehendes und Bekanntes vorbereitet werden. Ungleich verteilte Chancen sowie globale und ökologische Krisen erfordern vielmehr neue Perspektiven. Nur durch eine partizipative, dialogische und lebensweltorientierte Förderung werden Kinder dazu befähigt, bestehende Denkmuster zu hinterfragen und sich aktiv für eine nachhaltige wie auch (global) gerechte Zukunft einzusetzen.
Die vielfachen Bildungsgelegenheiten, die sich im pädagogischen Alltag aus dem Zusammenspiel individueller Förderung jedes Kindes und der Dynamik der Kindergruppe ableiten lassen, machen pädagogisches Handeln nicht planbar und immer mehrdeutig. Eine kindorientierte und inklusive Praxis ist zu vielschichtig, um mit sozialtechnologischen Managementmethoden wirksam gestaltet und weiterentwickelt zu werden. Weil pädagogische Fachkräfte unter Ungewissheitsbedingungen und Handlungsdruck begründete und passgenaue Lösungen finden müssen, benötigen sie theoretisches Fachwissen, Handlungssicherheit und die Fähigkeit, ihr eigenes Tun kritisch zu reflektieren. Die Grundlagen für diese professionellen Standards werden in einer fachlich einschlägigen Qualifikation mindestens auf Fachschulniveau gelegt.
Unterschiedliche Akteursgruppen steuern das KiTa-System auf mehreren Ebenen und brauchen dafür unterschiedliche Informationen. So sind auf der politisch-administrativen Steuerungsebene Daten notwendig, um Entscheidungen auf der Systemebene zu begründen. In der pädagogischen Praxis wiederum können Fachkräfte durch ihr Handlungswissen jedes Kind mit individuellen Fördermaßnahmen unterstützen. Dafür sind jedoch kontinuierliche, prozess- und kontextorientierte Beobachtung, Analyse und Reflexion notwendig – punktuelle Lernstandserhebungen können die dafür benötigten Informationen nicht bieten. Die politisch-administrative Steuerungsebene ist daher gefordert, hier die Voraussetzungen für partizipative und professionsfördernde Steuerungspraktiken zu schaffen.